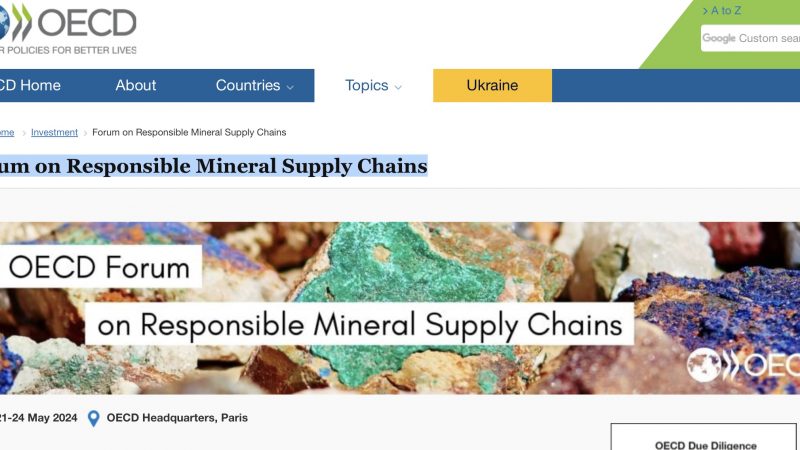Kabul and what’s next?

„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen
Und dass die Menschen nicht so oft weinen
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe
Dass ich die Hoffnung nie mehr verlier…“
Die von der deutschen Sängerin Nicole 1982 geträllerten Worte und die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik der vergangenen Dekaden waren deckungsgleich. Ein paar salbungsvolle Worte hier, ein paar Schecks und ein paar Soldaten dort – die Honigmasse, mit der so gut wie jeder Konflikt und jede Tragik auf der Welt zugekleistert wurde. Damit die Menschen nicht so oft weinen.
#Afghanistan2021 könnte ein Paradigmenwechsel für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein. Es dämmert uns langsam, was es letztlich bedeutet, wenn wir in gemeinsamem Schulterschluss mit den USA die Terroranschläge wie 9/11 als „Angriff auf uns alle“ verstehen. Vielleicht haben wir sogar „unsere Interessen am Hindukusch“ verteidigt – nur waren weder die Solidarität mit den USA, noch unser Einsatz in Afghanistan jemals so richtig ernst gemeint. Wir haben unser westliches Verständnis von Demokratie und unser Menschenbild eben nicht durchgesetzt, wir haben den Terror nicht besiegt, sondern sind stattdessen faule Kompromisse eingegangen, haben an das Gute im Menschen appelliert und den Frieden erhofft. Weil die harte Hand, der den Kampf suchende Soldat und der dadurch vernichtete Feind so gar nicht zu dem passen, was wir unter „ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen“ verstehen wollten.
Nicht verstanden, dass wir Kriegspartei waren
Wir haben in Afghanistan gar nicht verstanden, dass die westliche freiheitliche Welt eine Kriegspartei war. Wir fühlten uns mehr als Schiedsrichter. Eine gelbe Karte hier, eine rote Karte dort. Die Taliban haben sich klug zurück gezogen und dem materiell übermächtigen Gegner den Raum gegeben, den dieser für sich in Anspruch genommen hat. Wir dahingegen haben nicht nachgefasst und die Entscheidung gesucht. Wir waren immer eine Schutzmacht für die Unterdrückten und haben dabei in unserem Distrikt lieber Schulen gebaut als im nächsten Distrikt die Taliban erschossen. Irgendwie gefangen in der fatalen Ansicht, Afghanistan würde über die Zeit irgendwie demokratisch. Die Vernunft muss sich doch durchsetzen, dachten wir. Tut sie aber nicht. Dass wir dann noch ein korruptes scheindemokratisches System installiert haben, war ein weiterer Fehler.
In einer echten Demokratie beugt sich die Minderheit (wenn auch meist zähneknirschend) dem Willen und der Meinung der Mehrheit. So ist das aber nicht in Gesellschaften, in denen dieser demokratische Grundkonsens nicht existiert und die Kalashnikov neben dem Bett steht. Dort bestimmt die Partei, die die meisten Waffen hat und die meisten Menschen erschießt. Dort kann auch eine radikale Minderheit, wie die Islamisten, regieren – weil jeder, der etwas dagegen hat, erschlagen, erschossen, gehäutet, verbrannt, zerstückelt oder enthauptet wird. Deutschland hat dahingegen zwanzig Jahre an einem Krieg teilgenommen ohne ihn als einen solchen zu erkennen. Wer erinnert sich nicht an die Debatte, ob das in Afghanistan denn als Krieg bezeichnet werden darf. Ja, als was denn sonst? Ein Krieg ist ein Krieg und wenn er endet, dann ist Frieden. Dazu braucht es eine Partei, die siegt und eine, die unterliegt. So etwas lässt sich nun mal leider nur mit militärischen Mitteln lösen. Man siegt nur dann, wenn man den Feind vernichtet oder ihn zur Aufgabe bringt. Letzteres ist passiert. Der Westen hat aufgegeben. Die Taliban haben gesiegt.
Mehr Militarisierung deutscher Politik
Was folgt also auf diese Erkenntnis? Wir werden zu einer Militarisierung deutscher und westeuropäischer Politik in ausgesuchten Bereichen kommen müssen. Das ist nicht erfreulich, im Gegenteil. Aber es gibt eben kein „bisschen Frieden“, ein irgendwie geartetes Lavieren um die Konflikte und Krisen dieser Welt herum, ein sich irgendwie überall einmischen, allerorten seinen Senf dazu geben, ein irgendwie immer betroffen sein, eine Afghanistan-Konferenz hier, eine Libyen-Konferenz dort. Europa wird sich festlegen müssen, welche Konflikte in unserem Interesse sind und es daher nötig ist, eigenes Blut zu opfern und Feinde zu vernichten. Militärs sind dabei nicht dafür zuständig, Brücken und Schulen zu bauen. Die Bundeswehr und alle anderen verbündeten Armeen sind dafür da, zu kämpfen und zu siegen. Und wer Nation-Building betreiben will, muss es auch konsequent tun und nicht irgendwie im System rumfummeln, die falschen Leute installieren und ein Volk mit einer ungeliebten politischen Struktur allein lassen.
Dort, wo man nicht konsequent und nachhaltig vernünftig wirken kann (sowohl politisch wie auch militärisch), sollte man sich raushalten, trotz des dortigen Unrechts. Und weil dieses “raushalten” immer auch eine schlechte Option ist, die die Probleme der Welt nicht aus der selbigen schafft, muss man eben mehr Fähigkeiten entwickeln. Das betrifft die europäischen Armeen aber auch Entwicklungshilfe, Katastrophenhilfe, Kulturstiftungen, Gesellschaftsinitiativen, etc. Das fokussiert dann wieder auch eine Armee auf das, was diese können sollte, nämlich den Krieg zu beherrschen. Es braucht ein Deutschland, dass sich aber ebenso bewusst sein muss, dass Krieg eben nicht nur erst mit Waffengewalt, sondern auch weit darunter, schon mit hybriden Mitteln, geführt wird. Ein Land, dass sich einer steigenden Kriegsgefahr frühzeitig bewusst wird und nicht noch einmal zwanzig Jahre in einem Krieg ist, ohne zu merken, dass es einer ist. Stattdessen müssen wir uns langsam aber sicher eingestehen, dass schon längst Krieg in Bereichen stattfindet, die wir partout nicht so definieren wollen – Cyber, Handel, Biotechnologie. Wir müssen verstehen, dass um uns herum sicher auch “ein bisschen Frieden” ist aber auch jetzt schon viel, viel Krieg. Leider.